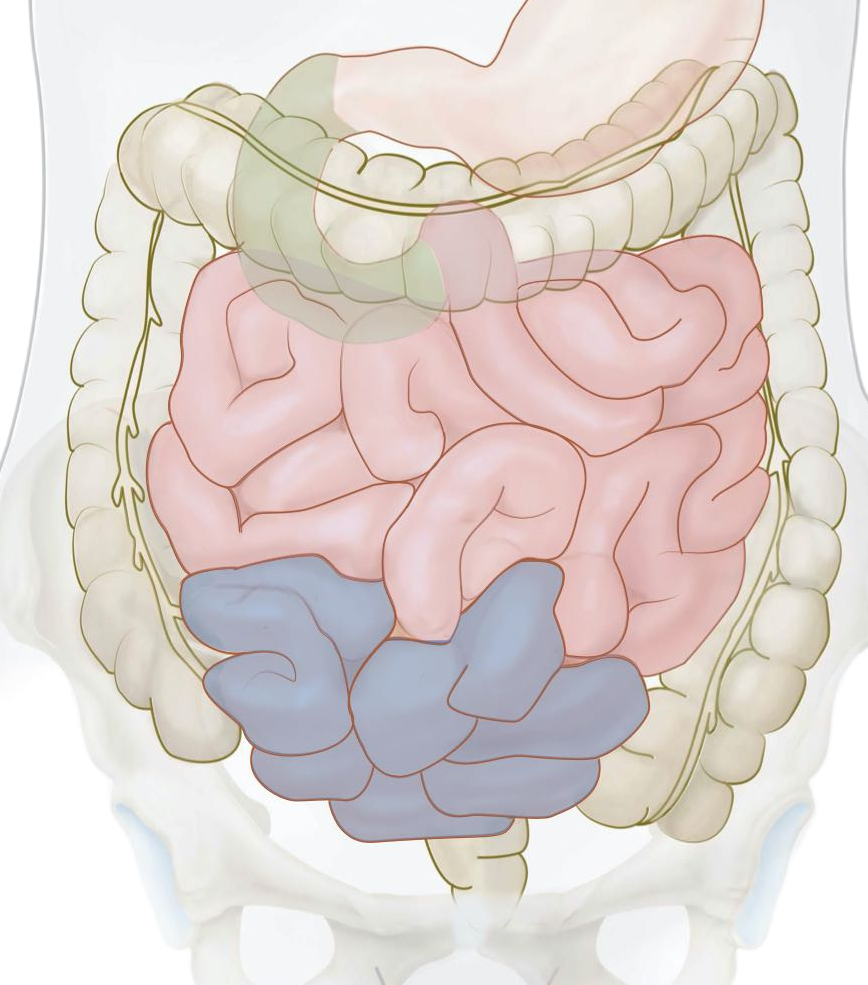
BAUCHSCHMERZEN
Bauchschmerzen sind ein häufiger Konsultationsgrund in der Hausarztpraxis. Stell dir vor, ein Patient kommt mit Bauchschmerzen zu dir in die Arztpraxis. Deine Aufgabe ist es, eine Mind-Map zum Thema „Differentialdiagnosen bei Bauschmerzen“ zu erstellen. Hilfreich ist beispielsweise eine Ordnung nach Schmerzintensität und/oder Lokalisation. Ziel dieser Aufgabe ist es, dich mit dem Thema Bauchschmerzen systematisch auseinanderzusetzen, damit du die nachfolgenden Kapitel sinnvoll bearbeiten kannst. Eine Musterlösung steht bereit.
Hier kannst du dir die aufgezeichnete Vorlesung zum Thema “Bauchschmerzen in der Hausarztpraxis” nochmal anschauen.
→ VORLESUNG: Bauchschmerzen in der Hausarztpraxis (SoSe 24)
Eine Gastritis gehört zu den häufigen Krankheitsbildern in der Arztpraxis. Weißt du, wie man einen Patienten mit Verdacht auf Gastritis als Hausarzt behandelt? Ihr verschreibt PPI’s für vier Wochen und bestellt den Patienten zur Nachkontrolle. Sollten sich die Symptome nicht gebessert haben, sollte man über eine Gastroskopie nachdenken und eine Überweisung schreiben. Wie du eine Überweisung zum Facharzt schreibst, übst du am besten gleich mal. Die Musterlösung gibt’s hier.
Sehr häufig der Grund von Magen-Darm-Beschwerden. Es handelt sich um eine Ausschlussdiagnostik, das heißt, deine erhobenen Befunde sollten unauffällig sein. Mach dir vor Lesen des Artikels über die Schritte der Diagnostik Gedanken. Wie würdest du als Arzt mit funktionellen (psychosomatischen) Bauchschmerzen umgehen? Du kannst dir dazu die Empfehlungen der S3-Leitlinien durchlesen. (Achtung Arztmodus! Interessant, aber nicht staatsexamensrelevant). Die Patienten berichten oft von jahrelangen Stuhlunregelmäßigkeiten und Beschwerden. Sie waren oft schon bei unzähligen Ärzten. Sie kommen häufig mit einer hohen Erwartungshaltung. Oft mit einer Menge Vorbefunden und Vortherapien. Oft auch mit mehreren Darm- oder Magenspiegelungen, bei denen in der Regel nichts gefunden wurde. Oft kann man bei Reizdarmpatienten über Gesprächsführung und symptomatische Therapien helfen. Buscopan hilft hier zum Beispiel manchmal. Auch pflanzliche Substanzen wie Kümmel oder Pfefferminzextrakte (z.B. Carmenthin) helfen. Die Stuhlrequenzen können oft durch Calcium, oder bewussteren Café Konsum beeinflusst werden. Hier gilt häufig, wer lindert hat Recht. Wichtig ist, dass man dem Patienten die Angst nimmt, etwas Schlimmes zu übersehen. Oft können die Patienten lernen mit ihrer “Anfälligkeit” zu leben. Das Ärzteblatt hat hierzu einen spannenden Artikel veröffentlicht, in dem das Patientenmanagement beschrieben wird. Für den Artikel klicke hier.
Achte hier besonders auf: unspezifische Gastroenteritis und klinisches Management der akuten Durchfallerkrankung (dieser Unterpunkt ist im Arztmodus zu finden).
→ AMBOSS-KAPITEL (Norovirus)
→ AMBOSS-KAPITEL (Lebensmittelvergiftung)
Wenn es um Magen-Darm-Erkrankungen geht, ist es immer wichtig, genau zu erfragen, ob auch andere im sozialen Umfeld, der Familie oder Freundesgruppe in den vergangenen Tagen erkrankt sind. Nicht zu vernachlässigen ist auch, genau nachzufragen, was gegessen wurde. Häufig entwickeln die Betroffenen eine starke Abneigung gegenüber einer bestimmten Mahlzeit in den letzten Tagen. Am schnellsten geht eine S. aureus Intoxikation. Bereits wenige Stunden nach dem Verzehr beginnt ein plötzlicher Brech-Durchfall mit starkem Krankheitsgefühl. Die gute Nachricht ist, dass es meist schnell vorbei ist. Nach wenigen Tagen ist man wieder vollauf. Schau dir auf der Lernkarte insbesondere die Tabelle der Gastroenteritiden an. Man sollte wissen, dass Toxine und Viren (z.B. Norovirus) schnell Symptome auslösen (innerhalb weniger Stunden), alles aber auch wieder schnell vorbei ist. Anders ist es bei bakteriellen Infektionen. Es dauert hier in der Regel ein paar Tage bis die Symptome beginnen. Ob eine antibiotische Therapie nötig ist, macht man in der Regel vom Risikoprofil des Patienten und der Stuhlkultur abhängig. Wichtig zu merken: wenige Stunden zwischen Verzehr und Beginn → eher nicht bakteriell.
Eine Appendizitis solltest du auf keinen Fall übersehen! Wichtig ist, dass es sich um eine klinische Diagnose handelt. Schau dir deswegen besonders gut klinische Zeichen und Sonografie-Bilder an! Bei Verdacht auf Appendizitis schreibt man eine Krankenhauseinweisung. Überlege, was für Informationen da alles drauf müssen! Hier gibt’s die Musterlösung.
IMPP-Renner: wichtig für das 2. Stex! Typisch für ältere Menschen mit Neigung zur Obstipation. Hinweis: In der Hausarztpraxis wird nur Typ 1 konservativ behandelt! Auf Amboss bitte genauen Fokus auf die ambulante Versorgung legen. Häufig kann man den Patienten Klistiere für zu Hause mitgeben und engmaschig kontrollieren. Solltest du nicht wissen, was das ist, oder wie man es anwendet, versuch das doch einmal heraus zu finden. Schau dir die möglichen antibiotischen Therapiemöglichkeiten an. Achtung, bei allen Medikamenten, insbesondere bei Antibiotika auch immer an mögliche Allergien (z.B. Penicillinallergien) denken.
Ein Ikterus gehört zu den „red flags“ der Hausarztpraxis: Hier sollte man aufmerksam werden. Wichtig sind vor allem die Diagnostik und Differentialdiagnostik. Schau dir die Pathophysiologie mit Einteilung in prä-, intra- und posthepatisch genau an. Außerdem sollte das Augenmerk auf der Differentialdiagnostik (Algorithmus und Tabelle liegen).
Hierbei könnte dir auch das Amboss Video „Differentialdiagnostik des Ikterus“ helfen.
Youtube:
→ PODCAST 1: Umgang mit Bauchschmerzen in der Hausarztpraxis
→ PODCAST 2: Red-Flags bei Bauchschmerzen in der Hausarztpraxis
→ PODCAST 3: Von der Praxis in die Notaufnahme
→ PODCAST 4: Von der Praxis in die klinische Gastroenterologie
Achtung: Es gibt noch weitere Red Flags, die vor allem in der Hausarztpraxis eine wichtige Rolle spielen. Ergänze diese Liste mit red flags, die im Podcast erwähnt wurden.
Wichtige Red-flags des Bauchschmerzes in der Hausarztpraxis sind (eine Auswahl):
Überlege dir doch einmal zu all den hausärztlichen Red Flags, an was man bei diesen Punkten denken muss und höre aufmerksam den Podcast.
→ AMBOSS-KAPITEL (M. Crohn)
→ AMBOSS-KAPITEL (C. ulcerosa)
Im letzten Podcast mit dem Gastroenterologen ging es um chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Diese Diagnose kann lediglich durch eine Biopsie bei der Koloskopie gesichert werden. Für den Hausarzt ist jedoch wichtig, dass sich Patienten häufig mit rezidivierenden Durchfallepisoden vorstellen. Fisteln oder perianale Abszesse sollten auch aufhorchen lassen. Es sollte in einem solchen Fall immer auch eine Stuhlprobe auf pathologische Keime untersucht werden. Dies muss 3 mal wiederholt werden, um wirklich einen Keimausschluss sicher zu stellen. Hier ist der Begriff “negativ prädiktiver Wert” zu nennen (wie wahrscheinlich ist es, dass ein negatives Ergebnis wirklich auch negativ ist). Mit 3 Tests kann man hier eine Sicherheit von über 96% erreichen. Calprotectin Bestimmung ohne Keimnachweis kann einen hochgradigen Verdacht auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung stellen. Nicht selten kann man eine Eisenmangelanämie feststellen, insbesondere wenn es in letzter Zeit viele Schübe gab. Die genaue Differenzierung zwischen Colitis oder Morbus Crohn überlassen wir dann den Gastroenterologen. Da die Lernkarten immer wieder vom IMPP gefragt werden, haben wir sie hier auch aufgelistet. Aber Achtung: verlier dich hier nicht. Schau dir insbesondere die Symptome und die Diagnostik an. Bei der Therapie ist der Hausarzt lediglich ausführender Arzt. Weißt du, was bei einer TNF-Alpha Therapie immer vorher ausgeschlossen werden muss? Weißt du, wie man mit Chemotherapeutika arbeitet? Mit diesen Mitteln passieren schnell Fehler. Daher gab es 2019 einen Roten Hand Brief zu der Nutzung von Methotrexat. (Zusammenfassung auf Amboss, Achtung Arztmodus!). Wichtig ist: Nur 1x wöchentliche Gabe und am Folgetag eine Folsäuregabe als Rescue Therapie. Ansonsten kommt es zu gefährlichen und potentiell tödlichen Überdosierungen. Daher muss der Hausarzt auch hier genau aufpassen und hinterfragen, wenn er Therapien anderer Ärzte umsetzt. Biologicals sind neue Mittel, die immer mehr auch in der Hausarztpraxis ankommen. Das Nebenwirkungsprofil ist zwar besser als bei Chemotherapeutika, dennoch kann es zu schweren Autoimmunreaktionen kommen. Langfristig kann es zu versteckten und schwierig zu erkennenden Schleimhautentzündungen kommen (Mukositis, Pericarditis, Pleuritis etc.). Bei einer Biological Therapie sollte der Arzt also regelmäßig abklären, ob solche Probleme aufgetreten sind und dann zusammen mit dem behandelnden Gastroenterologen eine Alternative finden.
Wann? Welchen Schauspielpatient hat meine Gruppe?
Wo ist meine Gruppe (Raum)? - siehe Kursplan Moodle/ Tickets Eventbrite/ E-Mail
Was müsst ihr mitbringen? - Kittel, Stethoskop, Mundschutz
Vorgeschichte Schauspielpatienten
→ Diagnostik falls nötig Frage nach Vitalparametern, Sonobild, U-Stix, Schnelltests (z.B. CRP, Influenza, COVID, D-Dimere, Troponin), Schwangerschaftstest, EKG, Rachenbefund, Otoskopie, Auskultationsbefund Lunge
Bei der Auflistung handelt es sich um Beispiele. Die Auflistung soll euch helfen zu wissen, nach was man im Seminar fragen könnte, wenn es klinisch Sinn macht.
→ Therapie ggf. Einleitung weiterer Schritte z.B. AU, Krankenhauseinweisung, grünes oder rotes Rezept, Facharztüberweisung, Physiotherapie, Sportübungen/ Dehnübungen
→ VIDEO BEISPIEL SIMULATION (→ hier gibt es wichtige Informationen zum Ablauf)
→ VIDEO BEISPIEL AUS DEM SEMESTER (→ hier siehst du wie es im Semester ablief)
Geh zum Abschluss noch einmal die folgenden klinischen Fälle durch und versuche dabei die Fragen eigenständig zu beantworten, bevor du dir die Lösung anschaust.
Die 32-jährige Frau Schmidt erscheint in deiner chirurgischen Praxis mit seit dem Morgen des Vortags bestehenden Bauchschmerzen. Sie berichtet, bereits am Vortag in einer Notaufnahme gewesen zu sein. Dort hätten die Ärzte bei unauffälligen laborchemischen Untersuchungen und nicht-pathologischem Ultraschall noch keine eindeutige Diagnose stellen können und sie wieder nach Hause geschickt. Sie solle sich am heutigen Tag zur Befundkontrolle bei einem niedergelassenen Kollegen vorstellen. In der Zwischenzeit hätten die Schmerzen zugenommen und seien nun am stärksten im rechten Unterbauch lokalisiert. Es bestehen keine Vorerkrankungen und Frau Schmidt verneint die Einnahme von Medikamenten.
Nenne mindestens drei intestinale Differenzialdiagnosen des rechtsseitigen Unterbauchschmerzes!
Wie lässt sich eine Gastroenteritis klinisch von einer akuten Appendizitis unterscheiden?
Nenne drei extraintestinale Differenzialdiagnosen des rechtsseitigen Unterbauchschmerzes!
Wie kann eine Ovarialtorsion diagnostiziert bzw. weitestgehend ausgeschlossen werden?
Wie kann eine Extrauteringravidität diagnostiziert bzw. weitestgehend ausgeschlossen werden?
Bei der Anamneseerhebung sollten auch Voroperationen erfragt werden. Warum ist das wichtig?
Generell ist die Anamnese wichtig, um die zahlreichen Differenzialdiagnosen von Unterbauchschmerzen einzugrenzen. Auch wenn die Symptome nur Hinweise sind – für welche Erkrankungen sprechen die folgenden unspezifischen(!) Symptome?
Fortsetzung Fallbericht
Frau Schmidt gibt das Schmerzausmaß auf einer Skala mit 4/10 an. Die Schmerzen hätten am Vortag begonnen und seien eher diffus und dumpf gewesen. Jetzt schmerze der rechte Unterbauch. Ihr sei übel, erbrochen habe sie aber nicht. Auf die Idee, Fieber zu messen, sei sie nicht gekommen. Sie habe keinen Durchfall und habe das letzte Mal am gestrigen Tag Stuhlgang gehabt. Die Miktion sei nicht beeinträchtigt. Eine Schwangerschaft halte sie zwar für unwahrscheinlich, könne diese aber nicht zu 100% ausschließen. Ihre Periode sei unregelmäßig. Vor ca. 2 Wochen habe sie eine leichte Blutung gehabt. An Grunderkrankungen gibt sie ein leichtes Asthma an. Operiert worden sei sie noch nie. Etwas besonderes gegessen habe sie nicht und habe auch keine Reise ins Ausland unternommen.
Worauf solltest du beim Ablauf der abdominellen Untersuchung bei rechtsseitigen Unterbauchschmerzen achten?
Ein Famulant hat Frau Schmidt bereits voruntersucht und übergibt folgende Befunde. Was versteckt sich hinter den Befunden?
Appendizitiszeichen: Schmerzhafte Druckpunkte (siehe Link oben)
Appendizitiszeichen: Schmerzhafte Manöver (siehe Link oben)
Blumberg-Zeichen - Klinisches Untersuchungszeichen - AMBOSS Video (siehe Link oben)
Fortsetzung Fallbericht
Die Anamnese und klinische Untersuchung mit positiven Appendizitiszeichen machen als Verdachtsdiagnose die akute Appendizitis wahrscheinlich, die weiterführende Diagnostik ist in deiner ambulanten Praxis jedoch nur eingeschränkt möglich. In deiner Praxis: Im Ultraschall siehst du heute etwas freie Flüssigkeit im Unterbauch. Dein Ultraschallgerät ist jedoch recht alt, sodass die Appendix nicht darstellbar ist. Du weist die Patientin mit Verdacht auf Appendizitis in eine Klinik mit einer gynäkologischen und chirurgischen Abteilung ein.
Was benötigst du für die Einweisung?
Wie wird der Notaufnahmearzt sehr wahrscheinlich vorgehen?
Akute Appendizitis
Akute Appendizitis
Welche Laborwerte interessieren dich in erster Linie?
CRP, Leukozyten (ggf. Diff. BB: Neutrophilie), PCT (TSH & Crea bei anstehender Kontrastmittel CT Untersuchung)
Das Pflegepersonal der Notaufnahme hat bei Eintreffen der Patientin bereits eine Untersuchung des Urins und eine Blutentnahme durchgeführt. Beide sind ohne pathologischenBefund (Ausschluss Schwangerschaft). Die digital-rektale Untersuchung ist nicht schmerzhaft (wird in der Realität oft nicht gemacht). Frau Schmidt wird jetzt sonografisch untersucht.
In der Ultraschalluntersuchung zeigt sich ein Kokarden-Phänomen. Worum handelt es sich dabei?
Das Kokarden-Phänomen kann sich bei der akuten Appendizitis zeigen. Es wird auch Schießscheiben-Phänomenbzw. Target-Phänomen genannt. In der Sonografie stellt sich die im Querschnitt getroffene entzündliche ödematös geschwollen Appendix dar. Dabei wechselt sich eine echoreiche mit einer echoarmen und wieder einer echoreichen Schicht ab.
Kokarden-Phänomen (Target-Sign) bei Appendizitis
Appendizitis mit Kokarden-Phänomen (Target-Sign)
Welche weiteren Befunde würdest du sonografisch bei Vorliegen einer akuten Appendizitis erwarten?
Welchen Stellenwert hat die Sonografie-Untersuchung in der Diagnostik der Appendizitis?
Der Allgemeinzustand von Frau Schmidt hat sich inzwischen verschlechtert, die Schmerzen und die Übelkeit haben zugenommen. Angesichts der Anamnese (wandernder Schmerz in den rechten Unterbauch) und dem klinischen Befund, zudem gestützt vom Ultraschallbefund (Kokarden-Phänomen), ist die Diagnose einer akuten Appendizitis nun überaus wahrscheinlich. Jetzt geht es zur Planung des operativen Eingriffs.
Der Verdacht auf eine Appendizitis rechtfertigt im Regelfall eine operative Therapie!
Welche beiden grundsätzlichen operativen Techniken sind dir bekannt?
Grundsätzlich können bei einer Appendizitis laparoskopische oder konventionelle Verfahren zum Einsatz kommen.
Erläutere die Durchführung des laparoskopischen Verfahrens im Rahmen einer Appendizitis-Operation!
Frau Schmidt ist einer Operation gegenüber sehr skeptisch eingestellt. Sie wünscht sich Aufklärung über Therapiealternativen zur Appendektomie.
Welche Therapiealternative zur Operation ist dir bekannt?
Welche Antibiotika können zur Behandlung einer akuten Appendizitis eingesetzt werden?
Erläutere die Risiken einer alleinigen antibiotischen Therapie bei akuter Appendizitis.
Antibiotikatherapie bei Appendizitis
Kalkulierte Antibiotikatherapie bei unkomplizierter bis perforierter Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis
Kalkulierte Antibiotikatherapie bei perforierter Appendizitis mit diffuser Peritonitis
Frau Schmidt hat sich letztendlich für die Operation entschieden und diese gut überstanden. Sie kann nach wenigen Tagen in die Häuslichkeit entlassen werden.
Bei der Entlassung fragt Frau Schmidt, da sie eine leidenschaftliche Joggerin ist, wie lange sie sich körperlich schonen muss.
Hausärztlicher Kommentar
Die Patientin wird vom Hausarzt nach der Untersuchung zur Wundkontrolle und ggf. auch zum Fäden entfernen aufgesucht (Post-OP Behandlung). In der Regel machen Sie eine Wundkontrolle und klären die Patientin über Entzündungszeichen, erneutes Fieber, zunehmende Schmerzen und Erschütterungsschmerz auf (Wiedervorstellung in der Hausarztpraxis). Sportliche Empfehlung. Hierbei ist es wichtig, auch als Hausarzt die verschiedenen Techniken und Komplikationen zu kennen. Zur Abschätzung sollte man wissen. War es eine offene Operation, laparoskopisch? War die Entnahme komplikationslos, oder lag eine Perforation vor? Bis zum Beginn der Fädenentfernung nach ca 7-10 Tagen sollte man warten. Auch sollte man mit der Patientin die ersten Belastungen besprechen. Lockerer Dauerlauf, Vermeidung von Bauchmuskeltraining für die kommenden 2-4 Wochen. Die akute Appendizitis ist mit einer Inzidenz von 124/100.000/Jahr ein recht häufig vorkommendes chirurgisches Krankheitsbild, dass auch in der Hausarztpraxis auftritt. Typischerweise beginnt es mit diffusen epigastrischen Schmerzen mit Schmerzwanderung in den rechten Unterbauch und wird oftmals von Fieber und Erbrechen begleitet. Es gibt jedoch auch untypische Verläufe dieses Krankheitsbildes. Hier ist bspw. die Altersappendizitis zu nennen, die zu weniger ausgeprägten Schmerzen mit überwiegendem Druckgefühl im rechten Unterbauch ohne Fieber oder subfebrilen Temperaturen führt. Auch veränderte Lagebeziehungen der Appendix (retrozökale Lage, höhere Lage bei Schwangeren) können zu einer untypischen klinischen Symptomatik führen. Als Differenzialdiagnosen sind u.a. gynäkologische, urologische und gastrointestinale Erkrankungen in Betracht zu ziehen.
Bei der akuten Appendizitis sind insb. die Anamnese und die klinische Untersuchung wichtig. Dabei sollten zumindest einige der Appendizitiszeichen geprüft werden. Urin- und Blutuntersuchungen sowie die Anforderung einer Bildgebung sind obligate Bestandteile der Diagnostik vor Einleitung einer operativen Therapie. Ergibt sich aus Anamnese und klinischer Untersuchung der Verdacht einer akuten Appendizitis, rechtfertigt dieser auch bei unauffälligen Laborwerten und fehlendem Nachweis einer akuten Appendizitis in der Bildgebung i.d.R. einen operativen Eingriff. Die Operation wird meist in laparoskopischer Technik durchgeführt, kann jedoch auch konventionell erfolgen. Alternativ kann nach Ausschluss einer freien Perforation eine alleinige Antibiotikatherapie als effektive Therapiealternative vorgeschlagen werden.
Themen zum Vertiefen
Tipps & Links
Der 54-jährige, leicht untersetzte Herr Bauer stellt sich abends in Begleitung seiner Ehefrau in der Notaufnahme mit Schmerzen im linken Unterbauch und reduziertem Allgemeinzustand vor. Die Schmerzen hätten vor etwa zwei Tagen eingesetzt und seitdem zugenommen. Herr Bauer habe zu Hause eine rektale Körpertemperatur von 38,2°C gemessen. Das Wasserlassen bereite ihm keine Probleme. Er habe nichts Besonderes gegessen, habe keine Auslandsreise hinter sich und habe dennoch in der letzten Zeit einen veränderten Stuhlgang, den er sich nicht erklären könne. Seine Frau sei nicht krank und wie ein Magen-Darm-Infekt fühle es sich nicht an. Manchmal habe er dünnflüssigeren Stuhl mit erhöhter Frequenz, dann wieder festeren und selteneren Stuhlgang. Blutbeimengungen habe er nie bemerkt. Eine Darmspiegelung habe er noch nie durchführen lassen, da er diese als erniedrigend empfinde.
Nenne mindestens drei wichtige Differenzialdiagnosen eines linksseitigen Unterbauchschmerzes!
Führe mindestens drei weitere nicht-chirurgische Ursachen linksseitigen Unterbauchschmerzes an!
Herr Bauer leidet passager an dünnflüssigen Stühlen. Wie lautet eigentlich die Definition einer Diarrhö?
Wie untersuchst Du klinisch das Abdomen?
Abdomen - Klinische Untersuchung - Abdomenuntersuchung - AMBOSS Video
Fortsetzung Fallbericht
Die Auskultation der Darmgeräusche ist über allen vier Quadranten unauffällig. Beim Abtasten des Abdomens beginnst du – da der Patient die Beschwerden als linksseitig geäußert hat – auf der rechten Seite. Schon während der rechtsseitigen Palpation wirkt der Patient äußerst geplagt. Als du dich dem linken Unterbauch näherst, toleriert Herr Bauer dies kaum. Über den Flanken kann kein Klopfschmerz ausgelöst werden. Herr Bauer verweigert die digital-rektale Untersuchung. Die Infektlabordiagnostik zeigt eine Leukozytose von 14.300/μL bei einem CRP von 18 mg/L (in der Praxis entweder auf Eilt, dann am selbigen Tag, oder auch mit einem Schnelltest).
Wie lautet die wahrscheinlichste Diagnose?
Die linksseitig lokalisierten Beschwerden, das Fieber und die Infektlabordiagnostik sowie die Unregelmäßigkeiten beim Stuhlgang legen als wahrscheinlichste Diagnose eine Sigmadivertikulitis nahe, zumal es sich hierbei um ein sehr verbreitetes Krankheitsbild handelt. Bei dieser umgangssprachlich als „Linksappendizitis“ bezeichneten Erkrankung leiden die Patienten unter linksseitigen Unterbauchschmerzen (bis zum akuten Abdomen), Fieber sowie eventuell blutig-schleimigen Stühlen. Wie lautet die Grunderkrankung und was ist hierunter zu verstehen?
Die Symptomatik einer Divertikulitis kann sich auch rechtsseitig, durch eine weit nach rechts ausladende Sigmaschleife oder im Colon ascendens lokalisierte Divertikel äußern. Zudem ist eine suprapubische Lokalisation nicht selten!
Welche weiterführenden diagnostischen Maßnahmen führst Du durch, um die Diagnose zu sichern?
Da die klinische Diagnose durch Anamnese, körperliche Untersuchung und Labordiagnostik nicht abschließend gesichert werden kann, kommt bildgebenden Verfahren für die Diagnostik der Divertikulitis eine bedeutende diagnostische und auch differenzialdiagnostische Rolle zu.
Nenne mindestens zwei ätiologische Faktoren der Grunderkrankung
Als ätiologische Faktoren der Sigmadivertikulose gelten:
Was ist ein Pseudodivertikel und worin besteht der Unterschied zu einem „echten“ Divertikel? (Dies interessiert das IMPP mehr als die hausärztliche Praxis)
Wie entsteht ein Pseudodivertikel und wie kann es zu einer Divertikulitis kommen?
Was sind neben der Divertikulitis weitere mögliche Folgen einer Divertikulose?
Komplikationen von Divertikeln
In der klinischen Praxis wird die Divertikulitis nach CDD eingeteilt. Wie sieht diese Klassifikation aus?
Anhand der Classification of Diverticular Disease (CDD) können Betroffene mit Divertikulitis im klinischen Alltag besser einem Behandlungszweig zugeteilt werden.
(Hausärztliche Kollegen & Kolleginnen kennen oft eher die Hansen & Stock Einteilung: im Amboss Kapitel direkt oberhalb der:
CDD Klassifikation
Welche konservativen Sofortmaßnahmen leitest du ein?
Sollte es ambulant nicht besser werden, wird der Patient eingewiesen (siehe auch Podcast Nr. 3). In der Zentralen Notaufnahme: Nachdem du Herrn Bauer einen intravenösen Zugang zur Applikation von Volumen und Schmerzmittel gelegt hast und er sich in die Linksseitenlage begeben hat, forderst du die Röntgen-Abdomenübersicht in zwei Ebenen an. Die Röntgenaufnahmen sehen weitgehend unauffällig aus. Es gibt keinen Anhalt für freie Luft, sodass du ohne Anhalt für eine Perforation keine sofortige Operation planen musst. Eine Sonografieuntersuchung kannst du, da sich der internistische Oberarzt bereits in den Feierabend verabschiedet hat, nicht mehr bekommen. Du nimmst Herrn Bauer stationär auf. (Daher versuche hier im Studium möglichst viel Erfahrung zu sammeln).
Welche Therapie leitest Du für den stationären Aufenthalt ein?
In der aktuellen Leitlinie werden Antibiotika zur Behandlung der Divertikulitis empfohlen. Welche kennst du? Warum? Welches für welche Erregergruppen?
Am Folgetag wird eine CT-Untersuchung durchgeführt. Diese lässt auf ein Sigmadivertikulitis-Stadium I (akute, unkomplizierte Divertikulitis) schließen, sodass aktuell keine Operationsindikation besteht. Nach wenigen Tagen konservativer Therapie kann die intravenöse Medikation auf orale Substanzen umgestellt werden. Nach einigen Tagen flüssiger Kost kann Herr Bauer den allmählichen Kostaufbau beginnen und in deutlich reduzierter Beschwerdesymptomatik in die Häuslichkeit entlassen werden. Er erhält die Maßgabe, die Antibiotikaeinnahme für einige Tage fortzuführen, bzw. sich erneut dem Hausarzt vorzustellen, um dort die ambulante Therapie, wie initial geplant fortzusetzen. Außerdem sollte er im Intervall, nach Abklingen der Entzündungssituation, eine Koloskopieuntersuchung durchführen lassen.
Warum wird während des stationären Aufenthaltes keine Endoskopie-Untersuchung durchgeführt?
Einige Monate später begegnet dir Herr Bauer erneut in deiner Praxis mit dem Bild eines akuten Abdomens. Der Patient präsentiert sich in einem schlechten Allgemeinzustand. Er ist äußerst schmerzgeplagt, das Abdomen abwehrgespannt. Er hat Fieber bis 39,2°C. Die Infektlaborwerte sind erhöht. Die Urinuntersuchung ist unauffällig.
Wie lautet die Definition eines akuten Abdomens?
Das „Akute Abdomen“ beschreibt einen akut schmerzhaften Zustand des Bauchraums, dessen Ursache zunächst meist unklar ist. An Symptomen zeigen sich starke Schmerzen, peritoneale Reizung, ein reduzierter Allgemeinzustand und evtl. eine Kreislaufdysregulation. Aufgrund der starken Schmerzen und der potenziell lebensbedrohlichen Erkrankungen muss eine schnelle Diagnostik und ggf. Therapie erfolgen.
Nenne mindestens drei Ursachen eines akuten Abdomens, deren Ursprung im rechten Oberbauch lokalisiert ist!
Wenn du mit dem Sono nicht weiter kommst, brauchst du stationäre Hilfe. Auch hier ist eine enge Absprache mit der Notaufnahme wichtig.
Du veranlasst die Durchführung einer Röntgen-Abdomenübersicht in Linksseitenlage.
Röntgen Abdomenübersicht (in Linksseitenlage) von Herrn Bauer
Was siehst du auf dem Röntgenbild?
Fortsetzung Fallbericht
Aufgrund des Befundes des Röntgenbildes wird der Entschluss zur sofortigen Operation ohne das Abwarten einer CT-Untersuchung gefällt. Intraoperativ zeigt sich eine kotige Peritonitis. Beim Durchmustern des Darmes fällt rasch als Ursache ein perforiertes Sigmadivertikel auf. Nach ausführlicher Durchmusterung des weiteren Gastrointestinaltraktes werden keine weiteren Lecks gefunden. Das Abdomen wird ausgiebig gespült und eine Hartmann-Situation hergestellt.
Was versteht man unter einer Operation nach Hartmann?
Unter einer Operation nach Hartmann ist eine Diskontinuitätsresektion mit Anlage eines endständigen Kolostomas zu verstehen: Hierzu erfolgt die Resektion eines Darmabschnittes, anschließend die Anlage eines Kolostomas und der Blindverschluss des Rektumstumpfes. Es handelt sich um eine mehrzeitige Operation, d.h. nach einigen Monaten kann das Stoma zurückverlegt werden.
Nenne mögliche Komplikationen darmresezierender Eingriffe (auch bei Kontinuitätsresektion)!
Herr Bauer wird postoperativ zunächst auf der Intensivstation überwacht und am Folgetag auf die periphere Station zurückverlegt. Allmählich beginnen Mobilisation und Kostaufbau. Die Anleitung der Stomaversorgung geschieht durch professionelles Personal. Nach insgesamt zehntägiger stationärer Behandlung kann Herr Bauer entlassen werden. Der Patient bringt einen Entlassungsbrief mit & bittet um Verordnung der weiteren Stomaversorgung (Hilfsmittelverordnung).
Drei Monate später stellt er sich zur geplanten Stomarückverlagerung wieder vor. Wir als Hausärzte sind hier involviert, denn bis dahin betreuen wir den Patienten. Auch stellen wir die erneute Indikation für einen erneuten Krankenhausaufenthalt: Elektive stationäre Einweisung. Wir überprüfen, dass der Patient einen Termin hat & weiß, was auf Ihn zukommt. Die Operation verläuft komplikationslos und nach fünftägiger stationärer Behandlung kann Herr Bauer nach Hause entlassen werden. Lediglich das Entfernen des Klammermaterials durch den Hausarzt steht wenige Tage später an.
Nach darmresezierenden Eingriffen dauert es häufig eine Weile, bis sich die Magen-Darmpassage normalisiert. Fallen Dir (mindestens zwei) Möglichkeiten ein, um die Darmtätigkeit anzuregen?
Hausärztlicher Kommentar
Die Divertikulose ist eine Darmerkrankung mit Ausbildung von Pseudodivertikeln (Ausstülpungen von Mukosa und Submukosa). Risikofaktoren für ihre Entstehung sind eine ballaststoffarme Ernährung, Bewegungsmangel, eine Bindegewebsschwäche und zunehmendes Alter. Eine Divertikulose bedarf zunächst keiner Therapie, Divertikel können aber zu behandlungsbedürftigen Entzündungen oder Divertikelblutungen führen.
Klinisch äußert sich die meist im Sigma lokalisierte Divertikulitis (Sigmadivertikulitis) typischerweise durch linksseitigen Unterbauchschmerz ("Linksappendizitis"), häufig einhergehend mit Stuhlunregelmäßigkeiten, Fieberund bei schwereren Fällen mit einem Peritonismus. Ein rechtsseitiger Schmerz schließt eine Divertikulitis nicht aus, denn auch im Zökum ist - wenn auch seltener - das Vorliegen von Divertikeln möglich.
In milden Fällen reicht neben einer Nahrungskarenz die Flüssigkeitssubstitution sowie die Gabe von Antibiotikaund Analgetika aus. Im Falle einer freien Perforation, einer Sepsis oder eines Ileus ist eine sofortige Krankenhausvorstellung notwendig. Von einer Koloskopieuntersuchung sollte im akuten, entzündlichen Stadium abgesehen werden; diese sollte zum Ausschluss eines Kolonkarzinoms im Verlauf während eines entzündungsfreien Intervalls angestrebt werden.
Themen zum Vertiefen
Meine Frau schickt mich: Älterer Herr mit Gelbfärbung der Skleren
Patientenvorstellung
Der 65-jährige Herr Hennes, ein Patient in normalem Ernährungs- und Allgemeinzustand, kommt zu Dir in die Notaufnahme. Er gibt an, nur gekommen zu sein, weil seiner Frau am Morgen eine Gelbfärbung seiner Augen aufgefallen sei. Er fühlt sich eigentlich wohl, auch wenn er in letzter Zeit etwas leicht ermüdbar sei. Abdominelle Beschwerden werden auf explizites Befragen verneint. Auf den ersten Blick fällt bei dem pensionierten Lehrer eine ausgeprägte Gelbfärbung beider Skleren auf.
Sklerenikterus
Frage 1
Welches Leitsymptom zeigt der Patient? Nenne mind. 3 Differenzialdiagnosen, die vorrangig in Frage kommen!
Für weitere Differentialdiagnosen eines Ikterus siehe auch Leitsymptomkapitel „Ikterus und Cholestase“
Frage 2
Welche Fragen sind in der Anamnese zielführend, um die Differenzialdiagnosen weiter eingrenzen zu können?
Antwort 2
Zusatzfragen
Eine wichtige Differenzialdiagnose bei schmerzlosem Ikterus ist die virale Hepatitis. Nenne die drei häufigsten Formen und ihre Übertragungswege!
Angenommen Herr Hennes wäre kürzlich im Urlaub gewesen. Welche Reiseziele würden zum Verdacht auf eine Hepatitis E passen?
In der Medikamentenanamnese solltest Du explizit auch nach unregelmäßig eingenommenen Medikamenten wie z.B. Schmerztabletten oder Nahrungsergänzungsmitteln fragen, da diese oft vergessen werden. Manche Patienten nehmen außerdem pflanzliche Zubereitungen ein, die sie nicht als Medikamente ansehen, und die daher ohne Nachfrage oft unerwähnt bleiben!
Körperliche Untersuchung
Herr Hennes verneint die Einnahme von Medikamenten. Er weist keine Risikofaktoren für virale Hepatitiden auf und gibt an, seit circa 20 Jahren täglich eine Schachtel Zigaretten zu rauchen (= 20 Pack-Years). Alkohol trinke er nur zu größeren Feiern und dann eher in geringen Mengen. In der Familienanamnese erzählt Dir der Patient, dass sowohl Mutter, Tante als auch seine Großmutter an einem Mammakarzinom erkrankt waren. Auf Befragen bestätigt Herr Hennes, dass der Urin tatsächlich etwas dunkler und der Stuhl heller seien, aber das hätte ihn nicht weiter beunruhigt. Du führst als nächstes eine körperliche Untersuchung durch.
Frage 1
Worauf solltest Du bei der körperlichen Untersuchung besonders achten?
Antwort 1
Frage 2
Es gibt zwei wichtige Untersuchungszeichen mit Bezug auf die Gallenblase. Nenne die Zeichen und erkläre ihre differentialdiagnostische Bedeutung.
Antwort 2
Abdomen - Klinische Untersuchung - Abdomenuntersuchung - AMBOSS Video
Diagnostik
Neben dem gelblichen Hautkolorit fällt Dir eine pralle Resistenz ohne wesentlichen Druckschmerz unter dem Rippenbogen in der Medioklavikularlinie (MCL) rechts auf. Sonst finden sich keine auffälligen Befunde, insbesondere gibt es keinen Hinweis auf Leberhautzeichen oder Aszites.
Du klärst Herrn Hennes über den Bedarf einer weiteren Abklärung auf und veranlasst eine Aufnahme auf eine internistische Station Deines Krankenhauses, um weitere Untersuchungen durchzuführen. Als erstes entscheidest Du Dich für eine Laboruntersuchung des Blutes.
Frage 1
Welche Laborparameter interessieren Dich vorrangig? Beachte hierbei eine sinnvolle Basisuntersuchung, die in jedem Fall erforderlich ist!
Antwort 1
Differenzialdiagnose des Ikterus
Auditor: Ikterus - Differentialdiagnostik
Quiz
Quiz: Laborkonstellation Ikterus | ||||
indirektes Bilirubin im Serum | direktes Bilirubin im Serum | Urobilinogen im Urin | ||
A | ↑ | ↑ | ↑ | Normal oder ↑ |
B | ↑↑ | Normal | Normal | ↑↑ |
C | Normal | ↑↑ | ↑↑ | Normal oder ↓ |
Interpretation A: Intrahepatischer Ikterus z.B. bei Leberversagen
Interpretation B: Prähepatischer Ikterus z.B. bei Hämolyse
Interpretation C: Posthepatischer Ikterus z.B. bei Choledocholithiases
Frage 2
Welche einfache apparative Untersuchung ist im vorliegenden Fall zielführend und sollte daher als erste durchgeführt werden? Welche Befunde sind ggf. zu erwarten?
Antwort 2
Hausärztlicher Kommentar
Was ist das Doppelflintenphänomen?
Weiterführende Diagnostik
Die angeforderten Laborwerte zeigen im kleinen Blutbild keine Auffälligkeiten. Transaminasen sind geringgradig erhöht, die Cholestaseparameter sind deutlich erhöht, insbesondere das direkte Bilirubin. Im Oberbauch-Sonogramm zeigt sich eine Choledochuserweiterung und auch eine Erweiterung der intrahepatischen Gallenwege. Der Bereich des Pankreaskopfes ist luftüberlagert schwer einsehbar, jedoch zeigt sich im Schwanzbereich eine Erweiterung des Ductus pancreaticus. Aufgrund dieses Befundes ist eine weitere Untersuchung des Blutes zunächst nicht vorrangig, deshalb entscheidest Du Dich, weitere apparative Untersuchungen zur Bestätigung der Verdachtsdiagnose einer Raumforderung der ableitenden Gallenwege durchzuführen.
Frage 1
Nehmen wir an, die Abdomen-Sonografie hätte keine Erweiterung der Gallen- und Pankreasgänge gezeigt. Welche Laboruntersuchugen wären dann indiziert gewesen?
Antwort 1
Frage 2
Welche apparativen Untersuchungen können durchgeführt werden und wann sind diese indiziert?
Antwort 2
Die MRCP stellt aufgrund der fehlenden Invasivität die bevorzugte Möglichkeit zur Darstellung der Gallen- und Pankreaswege dar, wenn zunächst keine Indikation zur Intervention besteht! Ist dagegen bspw. eine Steinextraktion oder Papillotomie erforderlich (bzw. besteht hochgradiger Verdacht auf die Notwendigkeit), wird eine ERCP durchgeführt!
Zusatzfragen
In diesem Fall besteht der Verdacht auf eine Raumforderung der ableitenden Gallenwege (z.B. ein Pankreaskopfkarzinom). Welchen Stellenwert haben Tumormarker in der Diagnose von Malignomen?
Allgemeinarztkommentar: Es ist verführerisch die Tumormarker zu bestimmen, aber es bringt leider oft bei akutem Ikterus auch oft falsch positive Ergebnisse Daher grade bei der Initialdiagnostik meiden! Grade CEA aber auch ca 19-9 können bei Obstrukt. Ikterus positiv ausfallen und führen häufig zu Verwirrung und Angst, s.a.:Publikation) Ihr fragt euch, welche Bildgebung wann sinnvoll ist? Schaut mal hier.
Befunde
Du führst eine ERCP und ein Abdomen-CT durch. Folgende Bilder erhälst du:
ERCP von Herrn Hennes
Abdomen-CT von Herrn Hennes
Frage 1
Wie beurteilst du die ERCP? Wie heisst das Zeichen, dass dort zu sehen ist?
Antwort 1
Befund mit Overlay:
Double-Duct Sign bei Pankreaskopfkarzinom
Frage 2
Wie befundest du das CT?
Antwort 2
Befund mit Overlay:
Zusatzfragen
Sollten vor der Durchführung der Kontrastmittel-CT weitere Laboruntersuchungen vorgenommen werden? Was gilt es weiterhin anamnestisch zu beachten?
Therapie
Herr Hennes wird über die Befunde im Beisein seiner Ehefrau aufgeklärt. Das Staging erbringt keinen Hinweis auf Metastasen. In der anschließenden Tumorfallkonferenz wird die Therapie geplant. Des Weiteren wird die Anbindung an die psychoonkologische Betreuung eingeleitet. Der Hausarzt wird hier häufig zu eingeladen. Auch wenn wir es oft terminlich nicht schaffen, sind es doch oft wir Hausärzte- & Hausärztinnen die diese wichtige Entscheidung mit den Patienten erneut abwiegen.
Frage 1
Welche Therapie würdest Du in diesem Fall vorschlagen? Welche Operationsverfahren gibt es beim Pankreaskopfkarzinom und wann werden diese eingesetzt? Beschreibe kurz das Vorgehen.
Antwort 1
OP-Prinzip der pyloruserhaltenden partiellen Duodenopankreatektomie (nach Traverso-Longmire)
OP-Prinzip der partiellen Duodenopankreatektomie (nach Whipple-Kausch)
Zusatzfragen
In der Familienanamnese erzählte Herr Hennes, dass Mutter, Tante und seine Großmutter an einem Mammakarzinom erkrankt waren. Diese Anamnese lässt auf ein hereditäres Mammakarzinom schließen, welchen Zusammenhang kannst Du zu Herrn Hennes Erkrankung herstellen?
Im Rahmen des Pankreaskarzinoms können paraneoplastische Syndrome auftreten, eines davon ist die Thrombophlebitis migrans. Welche Symptome sind hierfür typisch?
Frage 2
Über welche möglichen Komplikationen solltest du Herrn Hennes bezüglich der geplanten OP aufklären?
Antwort 2
Verlauf
Herr Hennes wird über die therapeutischen Möglichkeiten aufgeklärt und willigt in eine Operation mit anschließender Chemotherapie ein. Nach kurzem Aufenthalt auf der Intensivstation kann der Patient auf die chirurgische Normalstation übernommen werden. Mobilisation und Kostaufbau gestalten sich problemlos, sodass Herr Hennes nach zwei Wochen das Krankenhaus verlassen und sich in ambulante Chemotherapie begeben kann.
Frage 1
Herr Hennes fragt dich nach der Prognose seiner Erkrankung. Wie lautet die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit? (Häufige Frage in der PRAXIS)
Antwort 1
Die Überbringung schlechter Nachrichten erfordert Fingerspitzengefühl. In unserem Kapitel „Breaking Bad News“ findest du mehr dazu. (Auch bei unseren Hom-Kit Seminaren am Zentrum, oder vom Kompetenzzentrum Weiterbildung Saarland: KWS.
Hauzsärztlicher Kommentar
Entscheidend ist beim Vorliegen eines Ikterus die Frage nach Schmerzen. Liegen abdominelle Beschwerden vor, ist fast immer eine akute Ursache im Bereich der abführenden Gallenwege (insbesondere Choledocholithiasis) zu finden. Das im vorliegenden Fall genannte Courvoisier-Zeichen bei schmerzlosem Ikterus lässt sich in der Praxis zwar nicht so häufig feststellen (da es sich um ein Spätsymptom handelt), kommt aber im Rahmen der mündlichen Prüfung regelmäßig zur Sprache. Außerdem ist es ein schlechtes Zeichen (schwerere Erkrankung, da oft bösartig).
An dem hier dargestellten Fall ist weiterhin der Stellenwert der einzelnen diagnostischen Schritte besonders deutlich zu sehen. Die kostengünstige, risikofreie und schnell durchgeführte Abdomensonografie erlaubt dem erfahrenen Untersucher bereits eine starke Eingrenzung der Differenzialdiagnosen. So ist dagegen bspw. die ERCPunter dem Gesichtspunkt von Risiken nur dann indiziert, wenn eine unmittelbare therapeutische Konsequenz wie Papillotomie und/oder Steinextraktion damit verknüpft ist. Die Schnittbilddiagnostik dient weiterhin zur genauen Bestimmung der Tumorausdehung und der Suche nach möglichen Metastasen (präoperatives Staging). Anhand der Einsicht des chirurgischen Situs sowie der pathologischen Aufarbeitung des Tumorresektats erfolgt ein postoperatives Staging, um die Prognose genauer abzuschätzen und das weitere therapeutische Vorgehen zu planen.
Themen zum Vertiefen